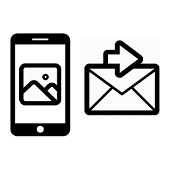Grau und trüb – so kennen wir den Januar. Eine echte Herausforderung, sich jetzt nicht einfach die Decke über den Kopf zu ziehen und sich zu verkriechen. Was ist mit all den guten Vorsätzen? Was Sie tun können, wenn Sie die so genannte Neujahrsmüdigkeit fest in der Hand hat und welche Ursachen dahinterstecken, erfahren Sie jetzt hier.
Neujahrsmüdigkeit – weniger Serotonin im Winter
Neues Jahr, neue Herausforderungen, neuer Antrieb? Fehlanzeige. Pünktlich zum neuen Jahr schwindet bei vielen Menschen der Antrieb. Das hat unterschiedliche Gründe: Nicht nur Bewegungs- und Lichtmangel sind schuld an der Neujahrsmüdigkeit. Auch die aktuelle Corona-Situation verstärkt die körperliche und auch oft emotionale Erschöpfung. Welche Auswirkungen der Lichtmangel im Winter auf den Körper hat, ist wissenschaftlich bewiesen. In der dunkeln Jahreszeit fehlt es an Botenstoffen wie Serotonin, dem Glückshormon. Dafür wird reichlich Melatonin produziert, das Schlafhormon. Darüber hinaus kann es zu einem Mangel an Vitamin D kommen und auch das kann auf Ihr Gemüt schlagen und Sie müde machen.
Frische Luft gegen Neujahrsmüdigkeit
Im grauen Januar verkriechen wir uns gerne, anstatt an die frische Luft zu gehen. Aber vom Rumliegen auf der Couch allein, werden Ihre Akkus auch nicht wieder aufgeladen. Gehen Sie also regelmäßig bei Tageslicht an die frische Luft. Machen Sie einen ausgiebigen Spaziergang. Das ist einfach aber sehr effektiv gegen Neujahrsmüdigkeit.
Erschöpfung durch Anspannung während der Feiertage
Auch die vergangenen Festtage sind Grund für die Erschöpfung zu Beginn des neuen Jahres. Wir steckten viel Kraft in die Vorbereitung damit alles perfekt ist. Dies geht oft mit einer großen inneren Anspannung einher. Deren Auswirkung wir erst spüren, wenn der Druck abfällt. Dazu kommt die Besonderheit der aktuellen Infektionslage und das Abwägen, mit wie vielen Leuten Sie sich treffen können oder wie häufig Sie sich dann testen sollten und so weiter. All dies kann äußerst ermüdend sein. Müdigkeitsanfälle lassen sich im oft stressigen Alltag nicht verhindern. Wir haben ein paar Tipps, um der Erschöpfung entgegenzuwirken.
Ausgewogen essen und trinken
Kennen Sie das? Müdigkeit nach dem Essen. Das können Sie ganz einfach umgehen: Nehmen Sie mehrere kleine Mahlzeiten zu sich und nicht drei große Portionen. Füllen Sie diese mit frischen, nährstoffreichen Nahrungsmitteln. Achten Sie besonders auf viel Vitamin B12 und Eisen – denn die tragen zum Energiestoffwechsel bei. Zucker und Kohlehydrate hingegen machen den Körper müde. Die „leeren“ Kalorien sollten Sie meiden. Knackiges Obst und Gemüse liefert eine super Alternative. Trinken Sie genug? Ausreichend Flüssigkeit ist das A und O für einen wachen und fitten Körper. Und dabei geht es nicht um die Tasse Kaffee am Morgen. Langfristig braucht der Körper Flüssigkeit in Form von ungesüßten Tees oder Wasser: am besten 2-3 Liter pro Tag. Als Richtwert gelten 35 Milliliter pro Kilo/Körpergewicht. Gute Nachricht: Über die Nahrung nehmen wir auch Wasser auf, in etwa 1 Liter. Besonders viel steckt zum Beispiel in Gurken, Tomaten, Radieschen oder Äpfeln.
Neujahrsmüdigkeit umgehen: guter Schlaf
Und wohl der naheliegendste Grund für Erschöpfung: Schlafmangel. Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend Schlaf bekommen, damit Sie tagsüber fit und munter sind. Dabei lohnt es sich, auch mal auf die innere Uhr zu hören. Die sagt Ihnen in der Regel, wann und wieviel Schlaf Sie brauchen. Ein gesunder Erwachsener benötigt im Durchschnitt zwischen sechs und acht Stunden Schlaf pro Nacht.
Schlafen Sie gut
Doch da ist nicht allein die Dauer entscheiden. Es hängt ebenso von der Qualität des Schlafes ab, wie erholt wir uns morgens fühlen. Lärm, Licht und andere Ablenkungen sorgen dafür, dass der Schlaf weniger erholsam für den Körper ist. Auch wenn es schwerfällt: Laptop, Tablet oder Handy gehören nicht ins Schlafzimmer. Sorgen Sie für ausreichend Dunkelheit über Vorhänge oder Jalousien. Gehören Sie zu den geräuschempfindlichen Menschen, können Sie auf Ohrenstöpsel zurückgreifen. So steht einem erholsamen Schlaf nichts mehr im Wege und Sie beugen effektiv Erschöpfung vor.
Bildquelle: ©Prostock-studio/stock.adobe.com