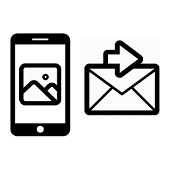Warum wir uns auf die zweite Lebenshälfte freuen dürfen
Jeder will es werden, aber keiner will es sein: alt! Das Alter hat in Deutschland ein sehr schlechtes Image. Vor allem wird es mit körperlichem und geistigem Verfall in Verbindung gebracht, mit chronischen Krankheiten, Gebrechen, Immobilität, Demenz, Depression und Verlust. Was soll am Alter gut sein? Dem entgegen stehen Erkenntnisse der Wissenschaft und der Altersforschung. Diese besagen, dass die meisten älteren und alten Menschen mit ihrem Leben viel zufriedener sind, als sie es in jüngeren Jahren waren. Es gibt gute Gründe, sich auf das Alter und das Älterwerden zu freuen.
„Nein, ich will keinen Seniorenteller“
Am Anfang des erfrischend heiteren Buches „Nein, ich will keinen Seniorenteller“ von Virginia Ironside gibt es diese amüsante Szene, in der sich die 59-jährige Ich-Erzählerin bei einer Dinnerparty mit einem Psychiater über das Alter streitet. Der Psychiater sagt: „Das Schöne am Alter ist, dass es nie zu spät ist. Man kann noch so vieles machen. Noch einmal studieren, Bungee-Jumping. Eine neue Sprache lernen …“ Darauf unsere 59-jährige Protagonistin: „Aber es ist sehr wohl zu spät! Das ist doch gerade das Schöne am Alter. Man muss nichts mehr studieren oder sich an einem Gummiband in die Tiefe stürzen! Gott sei Dank! Wie lange habe ich mich mit Schuldgefühlen herumgeschlagen, weil ich keine weitere Fremdsprache mehr gelernt habe. Aber jetzt, wo ich alt bin, brauche ich keine Gewissensbisse mehr zu haben. Aus und vorbei!“
Ein gutes Leben ist möglich
Ein lustiger Dialog, wie auch das gesamte Buch von Virginia Ironside allen zu empfehlen ist, die Angst vor dem älter werden haben und glauben, mit spätestens 60 sei alles vorbei. Denn auch wenn dann vieles nicht mehr möglich ist (zum Beispiel die 100 Meter in 10,0 Sekunden zu laufen), ist immer noch sehr viel möglich. Vor allem ist es möglich, ein gutes Leben zu führen. Darum geht es auch und vor allem in dem Buch „Die bessere Hälfte. Worauf wir uns mitten im Leben freuen können“ von Dr. Eckart von Hirschhausen und Prof. Dr. Tobias Esch. Den beiden Medizinern und Glücksforschern ist es ein Anliegen, „das alte und schädliche Bild des Älterwerdens von Siechtum und Windeln zum Wackeln zu bringen und mehr Lust auf die spannenden persönlichen Entwicklungschancen zu machen“.
Zufriedenheit mit steigendem Alter
Sie wollen mit dem weitverbreiteten Vorurteil aufräumen, dass ab der Lebensmitte, also mit 40 bis 45, der beste Teil hinter einem liege und es aber jetzt nur noch bergab gehe. Das Gegenteil nämlich sei der Fall: „Die zweite Lebenshälfte ist für die meisten von uns die bessere“, schreiben Hirschhausen/Esch. So seien „die meisten mit 57 zufriedener als mit 17 oder 27“.
Studien aus der Neurobiologie des Glücks
Esch, der an der Universität Witten/Herdecke forscht und lehrt und als einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet der Neurobiologie des Glücks gilt, kann seine positiven und optimistischen Aussagen über das Alter wissenschaftlich belegen. So hat er im Rahmen einer Studie 3.000 Menschen gebeten, ihren eigenen Lebensverlauf zu beurteilen. Dabei kam heraus, dass der Anteil von Menschen über 60, die eher zufrieden mit dem Leben insgesamt sind, gegenüber denen, die eher unzufrieden sind, bei zehn zu eins liegt. Eine andere Forschungsarbeit bestätigt diese Aussage: Danach waren über zwei Drittel der Menschen im Alter von 65 bis 85 Jahren mit dem eigenen Leben völlig zufrieden.
Paradoxon des Wohlbefindens im Alter
Interessant dabei: Während die körperliche Gesundheit nachlässt, steigt das psychisch-mentale Wohlbefinden an. Wissenschaftler sprechen hier vom „Paradoxon des Wohlbefindens im Alter“. Obwohl die körperliche und kognitive Leistungsfähigkeit nachlässt und dafür gesundheitliche Beeinträchtigungen häufiger werden, steigt die Lebenszufriedenheit. Das liegt, sagt die Psychologin Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello in ihrem Buch „Own your Age. Stark und selbstbewusst in der zweiten Lebenshälfte“ (Beltz-Verlag, 25 Euro), an psychischen Anpassungsprozessen und optimierten Bewältigungsstrategien, im Klartext daran, dass wir „mit fortschreitendem Alter ganz bewusst das Anspruchsniveau und die Vergleichsstandards an die veränderten Umstände anpassen“.
U-förmige Zufriedenheitskurve
Perrig-Chiello: „So werden von den Betroffenen etwa Ziele, die nicht mehr erreicht werden können, in ihrer Bedeutung relativiert, die Menschen geben sich mit weniger zufrieden. Man setzt neue Prioritäten im Leben oder man vergleicht sich mit jenen, denen es noch schlechter geht.“ Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unsere Lebenszufriedenheit U-förmig verläuft – man spricht von der „Zufriedenheitskurve“. Sie besagt: In der Jugend und im Alter sind wir glücklich und zufrieden, dazwischen hängen wir durch. Der Tiefpunkt liegt zwischen 45 und 49 Jahren.
Tiefpunkt mit Mitte vierzig
In einem Interview auf der Internetseite geo.de erläutert Pasqualina Perrig-Chiello diese U-Kurve so: „In der Jugend fühlen sich Menschen tendenziell stark und zufrieden, leben beflügelt von Hoffnungen und großen Erwartungen. Ab Mitte 30 aber beginnen sie, Wunsch und Wirklichkeit immer häufiger zu vergleichen – und das Glücksgefühl nimmt stetig ab, bis es einen Tiefpunkt erreicht. In Europa ist das bei 46 Jahren der Fall, in Schwellenländern bei 43 Jahren.
Das Erlebte wertschätzen lernen
Viele Menschen sind dann enttäuscht von der Vergangenheit und zugleich wenig hoffnungsvoll für die Zukunft, die zweite Lebenshälfte erscheint vielen geradezu bedrohlich. Nach ein paar Jahren allerdings vermögen die Menschen dann wieder das Gute zu sehen, sie schätzen, was sie erlebt haben und noch erleben können. Die Zufriedenheit nimmt im Durchschnitt wieder zu – und wird mitunter größer als je zuvor.“
Negatives einfach abschütteln
Aber woran liegt es, dass wir im Alter zufriedener sind, trotz der Handicaps und Einschränkungen, die damit verbunden sind? „Wenn wir älter werden, schütteln viele von uns den Ballast der Negativität ab“, sagt Glückforscher Esch. Es sei eine Tatsache, „dass Ältere besser darin sind, mit stressigen Situationen umzugehen. Sie lernen, sich nicht von kleinen Dingen ins Schwitzen bringen zu lassen. Viele Unannehmlichkeiten, die zuvor noch große Dinge waren, werden über die Zeit klein. Diese Form von Weisheit nimmt mit dem Alter zu.“ Dazu komme noch eins: „Je älter wir werden, desto weniger reagieren wir auf Ärger, Angst und Traurigkeit.“
Gelassenheit kommt mit dem Alter
Der 2015 verstorbene deutsche Philosoph Odo Marquard nannte in einem Interview, das er als 85-Jähriger zwei Jahre vor seinem Tod gegeben hatte, als einen Vorzug des Alters, dass man „sich nichts mehr beweisen müsse“. „Dies sorgt für mehr Gelassenheit. Man lernt über Fehler und Schwächen leichter hinwegzusehen. Im Alter kann man die Dinge eher mal laufen lassen.“
Die Killer der Lebenszufriedenheit im Alter
Obwohl die Lebenszufriedenheit im Alter quasi automatisch ansteigt (Glücksforscher Esch: „Der wichtigste Treiber der Zufriedenheit ist die Tatsache, über 60 Jahre alt zu sein.“), gibt es doch Umstände, die dieses verhindern. Die häufigsten „Killer der Zufriedenheit“ sind chronische Schmerzen und Krebserkrankungen, Verlust (z.B. des Partners, Verlust der Selbstständigkeit), soziale Isolation/ Einsamkeit und finanzielle Not. „Wenn die Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, dann wird es mit der Lebenszufriedenheit schwierig“, so Esch in einem Interview auf zeit.de.
Schmerzen und Krankheit trüben das entspannte Älterwerden
Und genau hier haken die Kritiker von Hirschhausen, Esch & Co ein. So hält es der Soziologe Dr. Fabian Kratz von der LMU München für einen „Mythos“, dass die zweite Lebenshälfte die bessere sei. „Bei vielen Menschen wird die zweite Lebenshälfte überschattet von Krankheit und vom Verlust von nahestehenden Menschen“, sagt er. Und weiter: „Es gibt individuelle Lebensverläufe, bei denen es steigendes Glück mit dem Alter gibt. Aber bei vielen Menschen ist das Alter ab 65 überschattet von gesundheitlichen Problemen. Und das zeigt die Forschung eindeutig: Es ist wahnsinnig schwer, glücklich zu sein, wenn man Schmerzen oder gesundheitliche Probleme hat.“
Urheber „©stock.adobe.com/Hayden West“