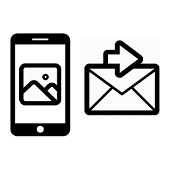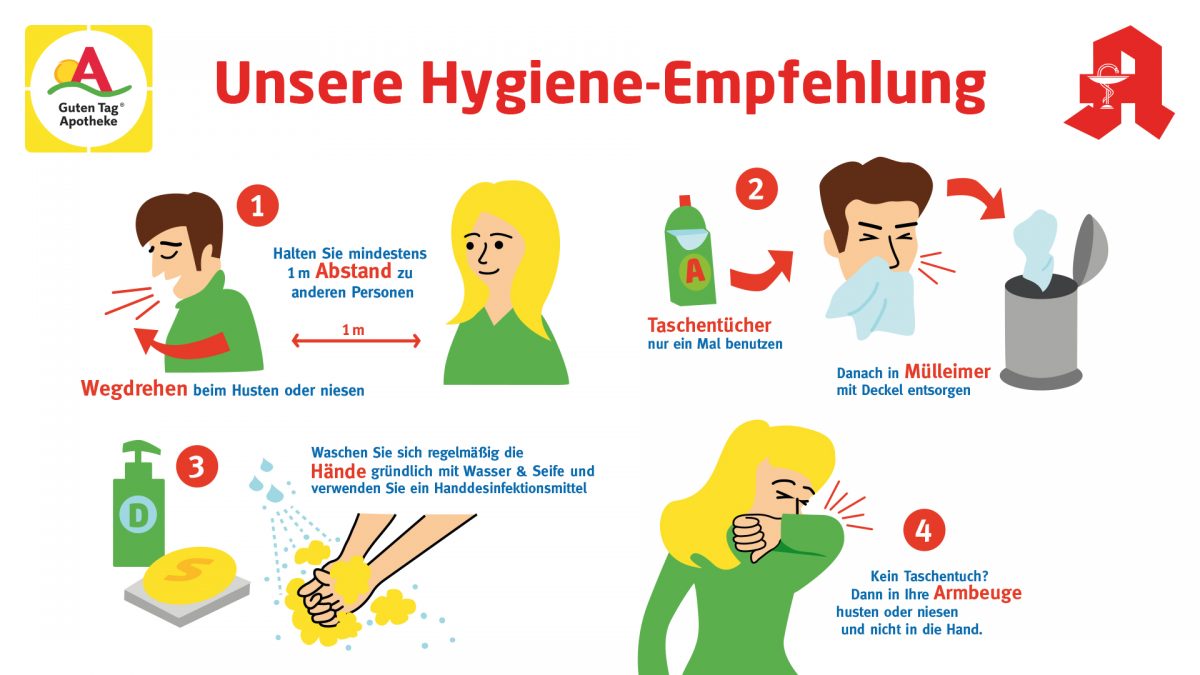Mandy Falke war 32 Jahre alt, als sie kurz vor Weihnachten 2017 die Diagnose Brustkrebs erhielt. Ein Schock für die Mutter von drei kleinen Kindern und die gesamte Familie. Plötzlich war nichts mehr wie vorher. Doch Mandy Falke nahm den Kampf gegen die schreckliche Krankheit auf und schaffte es, trotz allem wieder Freude am Leben zu haben. Für MEIN TAG erzählt Mandy Falke, durch welche Täler sie nach der Diagnose und während der Therapie gegangen ist, wie sie und ihre Familie mit der Krankheit heute leben und warum sie das Leben trotzdem gut findet.
„Ich fühlte mich vom Leben betrog“
32 Jahre war ich alt, als ich kurz vor Weihnachten die Brustkrebsdiagnose bekam. Mein jüngster Sohn war acht Monate alt und wurde noch voll gestillt. Meine anderen beiden Kinder waren drei und vier Jahre alt. Ich hatte kurz zuvor erst mein Psychologiestudium begonnen. Nun fühlte ich mich vom Leben betrogen.
„Muss ich am Krebs sterben?“
„Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie überleben“, sagte mir die Oberärztin, als ich die Tage zwischen Weihnachten und Silvester im Krankenhaus verbrachte. Es folgen 16 Chemos, eine beidseitige Brustentfernung, Entnahme der Lymphknoten und schließlich noch 33 Bestrahlungen und weitere Antikörperinfusionen. Ein zeitlich eng getaktetes Programm und trotzdem genug Zeit, um sich Gedanken zu machen: Muss ich an meiner Erkrankung sterben? Immer wieder kamen Gedanken an meine Kinder auf und ich brach unvermittelt in Tränen aus. Einmal saß ich im Bus und weinte. Ich fühlte mich so ohnmächtig.
„Ich versteckte meine Glatze nicht“
Mir fielen die Haare aus, anschließend auch die Augenbrauen. „Mamas Medizin wirkt so stark, dass sogar die Haare davon ausfallen“, erklärte ich den Kindern. Ich versteckte meine Glatze nicht und sie wurde zu unserer Normalität. Zu Ostern wollten die Kinder sie als Osterei bemalen und im Sommer bekam ich Gänseblümchenkränze aufgesetzt. „Du bleibst schließlich immer eine Prinzessin“, lachte meine Tochter dabei.
Selbst kuscheln funktionierte eine Zeit lang nicht
Nach meiner Brustentfernung konnte ich meinen jüngsten Sohn nicht mehr hochheben. Er war noch so klein und konnte nicht selbst laufen. Selbst kuscheln funktionierte eine Zeit lang nicht, weil mein Körper sofort in Panik vor den Schmerzen verfiel. Es erschien mir vorher so selbstverständlich, all diese Dinge machen zu können: Meine Kinder versorgen, sie auf den Arm nehmen und kuscheln. Und nun ging das nicht mehr.
Authentizität kindgerecht verpackt
Gegenüber unseren Kindern war uns Authentizität sehr wichtig, aber kindgerecht verpackt. Wir wollten keine unnötigen Ängste schüren. Solange keine Metastasen auftreten, besteht nicht die Gefahr, dass ich sterbe. Ich versuchte, Gefühle nicht zu verstecken. Wenn ich weinte, sagte ich meinen Kindern, dass ich traurig bin. Emotionen gehören zum Leben dazu. Wir weihten die Krippe und den Kindergarten ein und baten darum, uns eventuelle Auffälligkeiten im Verhalten der Kinder mitzuteilen. Ich selbst suchte eine Psychoonkologin auf, um eigene Verarbeitungsstrategien zu finden.
Langsam schlich sich Normalität inmitten vom Wahnsinn ein. Ich stellte fest: Krebs ist eine furchtbare Krankheit, aber deswegen ist nicht das ganze Leben blöd. Man kann krank sein und trotzdem lachen, lieben und Spaß am Leben haben. Traurig sein und trotzdem fröhlich. Ich musste erst lernen, dass ein Gefühlszustand nicht automatisch alle anderen ausschließt.
Es bedarf wirklich wenig, um glücklich zu sein
Es war befreiend zu erkennen, wie wenig es zum Leben eigentlich bedarf: Ich möchte gesund sein oder zumindest frei von Leid, und ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Ist es nicht schön zu erkennen, wie wenig es wirklich bedarf, um glücklich zu sein? Materielle Dinge haben für mich an Wert verloren. Auf dem Sterbebett wird man nicht an sein Auto denken, seinen Beruf oder sein Haus, sondern an die Menschen, die man lieben durfte und die einen, mit etwas Glück, auch zurückgeliebt haben.
Leben im Hier und Jetzt
Ich fühlte mich vor meiner Erkrankung nicht bewusst unsterblich, aber insgeheim hielt ich mich doch dafür. Die Unbeschwertheit ist nun weg. An deren Stelle ist das Gefühl der Präsenz getreten: Ich weiß nicht, ob ich in einem Jahr noch leben werde, aber ich weiß ganz sicher, dass ich es heute tun kann. Meine ungelösten Fragen oder Wünsche ließen sich plötzlich nicht mehr auf eine viel zu unsicher erscheinende Zukunft vertrösten. Diese Erkenntnis ist ein Fluch und ein Segen. Und es verwirrt mich selbst, aber das Leben ist jetzt besser und schlechter. Beides.
Irgendwann kehrte der Alltag zurück
Am Ende der Akutbehandlungen wartete kein „Hey, du hast so viel gelitten, hier ist deine Belohnung“-Pokal. Das Leben ging einfach weiter. Während der Krebsbehandlungen erschien es mir irrsinnig, mich über Banalitäten aufzuregen. Welche Rolle spielt es in fünf Jahren noch, ob mich der unfreundliche Nachbar gegrüßt hat oder nicht? Irgendwann aber kehrten die Alltagsprobleme zurück und ich fragte mich: Sollte ich angesichts einer lebensbedrohlichen Krankheit solchen Themen nicht gelassener gegenüberstehen? Es war befreiend sich einzugestehen: Ja, ich schätze das Leben nun viel mehr wert und ich darf mich trotzdem mit den kleinen Problemen des Alltags beschäftigen.
Was mir geholfen hat …
Ich lebe aktuell im dritten Jahr der Heilungsbewährung. So wird der Zeitraum fünf Jahre nach der Diagnosestellung bezeichnet. In dieser Zeit besteht eine erhöhte Gefahr, dass Metastasen auftreten. Ich bin also noch mitten in dieser kritischen Zeitspanne. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dies einmal sagen könnte, aber die Angst wird subjektiv tatsächlich weniger, auch wenn sie objektiv noch genau so viel Berechtigung beanspruchen könnte.
Gespräche und Spiritualität
Was mir geholfen hat, waren Gespräche mit anderen Betroffenen, fotografieren, schreiben und lesen. Ich fand meinen Zugang zur Spiritualität, der heute sehr wichtig für mich geworden ist und der mich daran glauben lässt, dass Geist und Körper auch unabhängig voneinander existieren können. Über meine Krankheitserfahrungen habe ich das Buch „Und dann am Leben bleiben“ geschrieben.
Das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit
Ich engagiere mich im Bereich Aufklärung, insbesondere hinsichtlich an Krebs erkrankter Elternteile. Auch mein Kinderbuch „Als Mama Krebs bekam“ fand seinen Weg in die Öffentlichkeit. Der von mir gegründete gemeinnützige Verein „Momente, die bleiben e. V.“ (www.momentediebleiben-ev.de) bietet zudem kostenlose Fotoshootings für Betroffene an. Mir helfen diese Tätigkeiten hinsichtlich der Verarbeitung des Krankheitsgeschehens. Zudem befriedigen sie mein aus der Krankheit heraus entstandenes Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit. Wenn ich etwas mache, was ich für sinnvoll halte, helfe ich anderen und gleichzeitig mir selbst.
Gehe nur Wege mit Herz
Anderen Betroffenen mag ich keine Tipps geben. Jeder Mensch und jede Erkrankung sind individuell. Für mich selbst hat sich jedoch der Leitspruch herauskristallisiert: Gehe nur Wege mit Herz. Und ich glaube heute nicht mehr, dass das Leben fair ist. Aber es ist trotzdem gut.
Bildquelle ©Mandy Falke/Privat